Expositionsmöglichkeiten
|

|
Allgemeine Expositionscharakteristik
|
|
|
Benzol ist der einfachste aromatische Kohlenwasserstoff und besitzt einen charakteristischen aromatischen Geruch. Es eignet sich als Lösemittel für ein breites Spektrum von Substanzen. Unter Normalbedingungen ist Benzol farblos, flüssig, chemisch stabil, leicht entzündlich, in Wasser nur schwach löslich, leichter als Wasser und leicht flüchtig [A - 10 / GESTIS / 2011; C - 7 / Wichmann / 2023].
In der Atmosphäre wird Benzol durch photochemische Prozesse mit einer Halbwertszeit von 3-10 Tagen abgebaut. Es ist ein natürlicher Bestandteil des Rohöls (maximal 0,4 g/L) und kann als Produkt unvollständiger Verbrennung organischer Verbindungen z.B. aus Heide- und Waldbränden hervorgehen. Niedrige Benzol-Konzentrationen in der Luft von Reinluftgebieten in der Bundesrepublik Deutschland (< 1 µg/m³) geben keinen Hinweis auf eine nennenswerte natürliche Bildung bzw. Freisetzung von Benzol in die Umwelt. Außenluftkonzentrationen von Benzol sind somit in erster Linie auf Aktivitäten des Menschen, insbesondere die Verwendung von Benzin und Öl, zurückzuführen [C - 7 / Wichmann / 2023].
Benzol besitzt als einer der wichtigsten Grundstoffe für die Produktion organischer Chemikalien eine besondere Bedeutung in der chemischen Industrie. Es ist unter anderem Ausgangsstoff für die Herstellung von Kunststoffen, Harzen, Pflanzenschutzmitteln, Farbstoffen sowie Waschmittelrohstoffen und wurde hauptsächlich auf Steinkohlebasis in Kokereien und seit den 50er Jahren überwiegend aus Erdöl hergestellt [C - 7 / Wichmann / 2023].
Als Schadstoff tritt Benzol hauptsächlich in Autoabgasen auf, kann aber auch als Verunreinigung im Trinkwasser und in Lebensmitteln vorkommen. Die Atemluft trägt mit über 90 % zur Gesamtbenzolaufnahme am meisten bei [E - 260 / BfR / 2024].
Für die Exposition der Allgemeinbevölkerung ist vor allem die Emission aus dem Kraftfahrzeugverkehr und die damit verbundene Freisetzung in unmittelbarer Nähe des Menschen von Bedeutung. Ungefähr die Hälfte des durch den Kfz-Verkehr freigesetzten Benzols stammt dabei direkt aus dem Treibstoff, die andere Hälfte bildet sich hauptsächlich aus anderen organischen Substanzen (z. B. dem Cyclohexan) beim Verbrennungsvorgang. Besonders betroffen sind Verkehrsteilnehmer, die in verkehrsdichten Bereichen wohnende Bevölkerung (Betankung, Abgase) und die Anwohner von punktuellen Emittenten (Feuerungsanlagen, Kokereien und Kraftstofflagern) [C - 7 / Wichmann / 2023].
Im Vergleich zu den Angaben Ende der 1980-er Jahre zeichnet sich insgesamt ein deutlicher Rückgang der Emissionen ab. Diese Verminderung ist in erster Linie auf emissionsreduzierende Maßnahmen beim Kfz-Verkehr (vor allem durch die Einführung des Drei-Wege-Katalysators und des sog. „Saugrüssels“ in Tankstellen) und durch den Abbau von Emittenten (z. B. Kokereien) in der Montanindustrie verursacht. Ein weiterer Rückgang der Emissionen wird auf die Begrenzung des Benzolgehalts im Benzin auf 1 % in der EU im Jahr 1998 zurückgeführt. Parallel zum Rückgang der Emissionen kann generell – bei großflächiger Betrachtung – auch eine langsam zurückgehende Immissionsbelastung insbesondere in den Ballungsräumen beobachtet werden [C - 7 / Wichmann / 2023].
Der inhalative Pfad ist der wichtigste Aufnahmeweg bei beruflicher und umweltbedingter Exposition. Nach Abschätzungen beträgt die durchschnittliche inhalative Benzolaufnahme (ohne Tabakrauch, nicht beruflich exponierten Erwachsene, ohne direkte Verkehrsbelastung, Deutschland) etwa 60 µg/d [C - 7 / Wichmann / 2023; C - 150 / EHC / 1993].
Innenräume können insbesondere durch Tabakrauch mit Benzol belastet sein. Das Rauchverhalten stellt die zweite große Einflussgröße für die individuelle Benzolbelastung dar. Zigarettenrauch enthält etwa 10-100 µg/ Benzol pro Zigarette bzw. 150-240 µg/m³ im Hauptstrom. Nach Schätzung beträgt die inhalative Zufuhr von Benzol bis zu 30 µg pro Zigarette [C - 133 / RAR / 2008; C - 7 / Wichmann / 2023].
Benzol wurde auch in Erfrischungsgetränken sowie in Karottensäften für Säuglinge und Kleinkinder nachgewiesen, wobei eine Entstehung bei der Verarbeitung und Lagerung aus Benzoesäure (Konservierungsstoff) und Ascorbinsäure (Vitamin C, Antioxidationsmittel) bzw. aus Karotteninhaltsstoffen durch starkes Erhitzen zu Sterilisationszwecken vermutet wird. Eine Bewertung des gesundheitlichen Risikos wurde nicht vorgenommen, wobei die maximale Aufnahmemenge durch die Produkte sowohl für Kleinkinder als auch für Erwachsene gegenüber der Aufnahme über die Atemluft deutlich geringer abgeschätzt wurde. Da sich für Benzol keine Aufnahmemenge festlegen lässt, die gesundheitlich unbedenklich ist, sollte der Benzolgehalt in Lebensmitteln nach Auffassung des BfR (Bundesinstitut für Risikobewertung) so weit wie möglich reduziert werden [E - 260 / BfR / 2024; E - 262 / BfR / 2013].
Insgesamt spielt die orale Aufnahme von Benzol aus Nahrungsmitteln und Trinkwasser für die Belastung i.d.R. eine untergeordnete Rolle. Im Falle von akuten Vergiftungen durch Verschlucken von Benzol oder benzolhaltigen Flüssigkeiten kann die orale Aufnahme von Bedeutung sein [C - 7 / Wichmann / 2023; C - 150 / EHC / 1993].
Die dermale Aufnahme kann bei Kontakt von flüssigem Benzol bzw. benzolhaltigen Flüssigkeiten mit der Haut von Bedeutung sein [C - 7 / Wichmann / 2000; C - 150 / EHC / 1993].
|

|
Verwendung
|
|
|
Produktionsmengen
Einzelsubstanz
In Deutschland wird die Produktion für die
Jahre 1994-2005 mit ca. 2-2,7 Millionen t und für die
Jahre 1983-1993 mit ca. 1,3-1,7 Millionen t
angegeben [C - 49 / Rippen / 2023].
Die ECHA (European Chemicals Agency) führt Benzol als Einzelsubstanz, die im Europäischen Wirtschaftsraum in einer Menge von 1.000.000 bis 10.000.000 Tonnen pro Jahr hergestellt und/oder eingeführt wird [C - 527 / ECHA, RAC / 2018b, Annex 1, S. 15f].
Als Bestandteil/Verunreinigung
Darüber hinaus ist Benzol auch als Bestandteil/Verunreinigung in vielen anderen Stoffen enthalten. Die ECHA listet 128 registrierte Stoffe mit einem Benzolgehalt zwischen 0,1 und 1,0 % (w/w) und 97 registrierte Stoffe mit einem Benzolgehalt von mehr als 1,0 % (w/w). Bei den registrierten Stoffen handelt es sich hauptsächlich um Benzin, Naphtha, Destillate aus Erdöl oder Kohlenteer oder andere Arten von Kohlenwasserstoffen, wobei es beispielsweise
159 aktive Registranten für den Stoff "Benzin" (CAS-Nr. 86290-81- 5),
30 aktive Registranten für "Naphtha (Erdöl) (CAS-Nr. 64741-41-9) und 2 aktive Registranten für "Destillate“ (Erdöl) (CAS-Nr. 68410-05-9) gibt. Diese werden im Europäischen Wirtschaftsraum wiederum in einer Menge von
100.000.000 bis 1.000.000.000 t/a (Benzin)
10 000 000 bis 100 000 000 t/a (Erdöl)
100.000 bis 1.000.000 t/a (Erdöldestilate)
hergestellt und/oder eingeführt [C - 527 / ECHA, RAC / 2018b, Annex 1, S. 14f].
Emmissionsbedingte Freisetzung
Für Deutschland (Jahr 1992) werden
46.000 t/a Gesamtemissionen davon,
41.000 t/a durch Kfz-Verkehr,
2.000 t/a durch Benzintransport und durch Verdunsten beim Tanken,
4.000 t/a aus der Industrie (davon 450 t/a aus der Großindustrie)
abgeschätzt [C - 49 / Rippen / 2023].
Für Deutschland (Jahr 2010) werden
7.714 t/a Gesamtemissionen davon,
5.308 t/a durch Kfz-Verkehr,
151 t/a durch Tankatmung und Tanklager,
1.105 t/a aus der Industrie (davon 655 t/a aus der Großindustrie)
200 t/a aus Laboratorien
abgeschätzt [C - 7 / Wichmann / 2023].
Industrielle und gewerbliche Verwendung
Herstellung:
Während bis in die 1940-er Jahre Benzol hauptsächlich auf Steinkohlebasis in Kokereien gewonnen wurde, wird es seit den 1950-er Jahren überwiegend aus Erdöl hergestellt [C - 7 / Wichmann / 2023], hauptsächlich durch katalytisches Reforming, Steamcracking und Dealkylierung oder durch Rückgewinnung während der Herstellung von Chemikalien, vor allem aus Nebenprodukten von Kokereien [C - 527 / ECHA, RAC / 2018b, Annex 1, S. 15f].
Gehalt in Ausgangsstoffen:
Steinkohlenteer
950 mg/kg (4000 mg/kg der Trockenmasse,2 % des Teers, im Gesamtteer inkl. entwichenem Leuchtgas-Anteil ca. 20 %, DE) [C - 49 / Rippen / 2023].
Braunkohlenteer
(3,1 %) [C - 49 / Rippen / 2023].
Rohöle verschiedener Herkunft
<0,001-0,71 %, (Mittelwert 0,161 %, n=86)
andere Quellen berichten Konzentrationen von maximal 400 mg/L
[C - 49 / Rippen / 2023]
Industrielle Verwendung:
Als Zwischenprodukt bei der Herstellung von organischen Chemikalien, Pharmaka, Farbstoffen, Kunstleder, Linoleum, Flugzeug-Schmiermitteln und Lacken [C - 49 / Rippen / 2023].
Verwendete Mengen (in % Massenanteile der gesamten Menge), Jahr 1992, DE zur Produktion von:
Ethylbenzol/Styrol: 50 %
Cumol/Phenol: 21 %
Cyclohexan: 12 %
Nitrobenzol: 10 %
Alkylbenzolen (f. Tenside): 3 %
Sonstige (u.a. Chlorbenzol und Benzolsulfonsäure): 4 %
[C - 49 / Rippen / 2023]
Benzol wird auch als Extraktionsmittel eingesetzt [A - 45 / Pubchem / 2024].
Gewerbliche Verwendung:
Lösungsmittel für Wachse, Öle, Harze [C - 49 / Rippen / 2023].
Gehalte in Malereizubehör
4-390 mg/kg (Farben, Verdünner usw., n= 41 von 82, DK, ca. 1992) [C - 49 / Rippen / 2023].
Verbraucherprodukte
In Kraftstoffen dürfen seit dem Jahr 1998 maximal 1 % Benzol enthalten sein [C - 530 / EU / 2023].
Der Benzolgehalt im Benzin in Deutschland wird vor 1998 angegeben mit ca.
80 % (ca. Jahr 1920, Normalbenzin)
6 % (ab ca. Jahr 1940, Normalbenzin)
3-4 % (ca. Jahr 1977, Normalbenzin)
5-6 % (ca. Jahr 1977, Superbenzin)
0,5-4,5 % (Mittelwert: 2,0 %, n=43, Jahr 1985, Normalbenzin bleifrei)
0,7-4,8 % (Mittelwert: 1,85 %, n=138, Jahr 1985, Normalbenzin verbleit)
1,0-6,0 % (Mittelwert 3,0 %, n=139, Jahr 1985, Superbenzin verbleit)
2,5 % (Jahr 1994, Ottokraftstoff gesamt)
< 1 % (seit Jahr 1998)
[C - 49 / Rippen / 2023]
Weitere Angaben
Es liegen keine Angaben vor.
|

|
Vorkommen
|
|
|
Vorkommen in der Luft
Außenluft
Benzol-Immissionen unterliegen in Abhängigkeit von der Intensität des Kfz-Verkehrs in verkehrsdichten Regionen einem ausgeprägten Tagesgang, mit Spitzenwerten zu den sog. Rush-Hour-Zeiten. Durch den zusätzlichen Einfluss von Groß- und Kleinfeuerungsanlagen kann im Winterhalbjahr ebenfalls großflächig ein Anstieg der Benzol-Immissionskonzentrationen nachgewiesen werden [C - 7 / Wichmann / 2023].
Die Benzol-Konzentrationen in der Außenluft sind in den letzten Jahrzehnten um etwa eine Größenordnung gesunken, vor allem durch die Begrenzung des Benzol-Gehaltes in Kraftstoffen Ende der 1990-er Jahre. Seit 2010 gilt laut BImSchG / TA Luft (GMBl 2021 Nr. 48-54, S. 1050) für Benzol ein Jahresmittelgrenzwert in der Außenluft in Höhe von 5 µg/m³. Dieser wird in Deutschland seit 2014 an allen Messstationen der Länder und des Bundes unterschritten [D - 1334 / AIR / 2020].
typische Außenluft Jahresmittelwerte (DE, ca. 1990):
< 1 µg/m³ (ländliche Gebiete)
5-10 µg/m³ (Ballungsgebiete)
7-15 µg/m³ (Emittentennahbereich, Kokereien)
20-30 µg/m³ (Emittentennahbereich, Kfz)
[C - 49 / Rippen / 2023]
8-48 µg/m³ (Emittentennahbereich, KfZ (Straßenschluchten), Publikation 1995, 1996) [C - 7 / Wichmann / 2023]
Außenluft Jahresmittelwerte (DE, 2021):
0,18-0,51 µg/m³ (ländliche Gebiete, Hintergrund)
0,42-0,58 µg/m³ (vorstädtische Gebiete, Hintergrund)
0,44-0,81 µg/m³ (städtische Gebiete, Hintergrund)
0,5-2,98 µg/m³ (städtische Gebiete, Industrie)
0,55-1,4 µg/m³ (städtische Gebiete, Verkehr)
[C - 7 / Wichmann / 2023]
Außenluft Jahresmittelwerte (NRW, DE, 2023):
0,2-2,4 µg/m³ (gesamt)
0,2 µg/m³ (urbane Bereiche und ländlicher Raum, Hintergrund)
0,4 µg/m³ (urbaner Bereich, Hintergrund)
0,7-0,9 µg/m³ (urbane Bereiche und ländlicher Raum, Verkehr)
0,6-1,2 µg/m³ (urbane Bereiche, Verkehr)
0,8-2,4 µg/m³ (urbane Bereiche, Industrie)
[C - 248 / LANUV, NRW / 2024]
1,4 µg/m³ (Mittelwert, 7-Tage-Messungen; n=74, vier Orte, DE, 2001-2002) [C - 49 / Rippen / 2023].
Raumluft
Eine Aufstellung über Innenraumbelastungen in Deutschland enthält die folgende Tabelle 1:
Tabelle 1: Benzolkonzentrationen in der Raumluft in Deutschland
| Innenraum/Zeitraum | N | Median | 95.Perz. | Maximum | Referenz | | | [µg/m³] | [µg/m³] | [µg/m³] | |
|
|
|
|
|
| | Wohnungen | | 1985-1986 | 479 | 7,2 | 22 | 90 | Kause et al. 1991 | | 2003-2006 | 555 | 1,8 | 7,7 | 61 | UBA 2008 | | 2006-2012 | 717 | 1,0 | 4,0 | - | Hofmann et al. 2014 | | 2015-2017 | 620 | 1,1 | 4,5 | 29 | UBA 2019 in AIR 2020 |
|
|
|
|
|
| | Gemeinschaftsräume (Schulen und Kitas) | | 1990-1993 | 395 | 1,5 | 5,0 | - | UfU 1994 | | 2004-2005 | 165 | 0,3 | 4,0 | 8,0 | Fromme et al. 2008 | | 2005-2007 | 285 | <1,0 | 2,0 | 5,0 | LAsD 2009 | | 2006-2012 | 499 | 1,0 | 3,1 | - | Hofmann et al. 2014 |
|
|
|
|
|
| | Büro | | 2006-2012 | 1769 | 1,0 | 4,0 | - | Hofmann et al. 2014 |
|
|
|
|
|
|
verändert aus [D - 1334 / AIR / 2020]
[C - 458 / Hofmann et al. / 2014; D - 683 / UBA / 2008; D - 776 / Krause et al. / 1991; D - 1042 / Fromme et al. / 2008; D - 1334 / AIR / 2020; D - 1339 / UfU / 1994; D - 1340 / LAsD / 2009]
Insgesamt ist in Deutschland ein Rückgang der Medianwerte von 2,0 µg/m³ in 2002 auf 0,5 µg/m³ in 2012 und des 95. Perzentils von 7,0 auf 3,0 µg/m³ zu verzeichnen [C - 458 / Hofmann et al. / 2014].
Innenraum (Appartements; n=278, Berlin, D, 1994):
4,7 µg/m³ (MW Raucher),
3,0 µg/m³ (MW Nichtraucher)
KFZ-Innenraum:
5,3-10 µg/m³ (Taxis, Barcelona, ESP, Publikation 2019) [C - 7 / Wichmann / 2023].
12 µg/m³ (MW, MIN-MAX: 4-29 µg/m³, Publikation 1995) [C - 7 / Wichmann / 2023].
Vorkommen im Wasser
Trinkwasser
160 ng/L (DE, 1975/76)
18-45 ng/L (DE, ca. 1990)
[C - 49 / Rippen / 2023]
260 ng/L (Maximum, n=1469, n=1
In den Jahren 2017 bis 2019 wurde in Deutschland der Grenzwert der TrinkwasserV von 1 µg/L an allen untersuchten Messstellen der Wasserversorgungsgebiete in denen im Durchschnitt mehr als 1.000 m³ Trinkwasser pro Tag verteilt oder mehr als 5.000 Personen versorgt werden, eingehalten [C - 528 / UBA / 2021].
Oberflächengewässer
Fließgewässer
30-650 ng/L (Rhein, Mittelwert 170 ng/L, n~48; D, 1983) [C - 49 / Rippen / 2023]
Rhein (Kleve-Bimmen, NW, D):
1985: < 100 ng/L
1986: 100 ng/L
2015: max. 2.300 ng/L (n=13 von 745 Messwerten an 143 Tagen)
2016: max. 1.100 ng/L (n=44 von 2005 Messwerten an 325 Tagen)
[C - 49 / Rippen / 2023]
Rhein (Weil, BW, D):
2015: < 250 ng/L (n=365)
2016: < 250 ng/L (n=364)
Rhein (Lauterbourg/Karlsruhe, FR/BW, D):
2015: max. 30 ng/L (n=4 von 350)
2016: < 500 ng/L (n=317)
[C - 49 / Rippen / 2023]
Vorkommen im Boden
1.000 und 2.000 µg/kg (Gaswerk-Standort, NL, ca. 1986) [C - 49 / Rippen / 2023].
500-17.000.000 µg/kg (Gaswerk-Standort, nahe Kopenhagen, DK, ca. 1987) [C - 49 / Rippen / 2023].
Vorkommen in Lebensmitteln
Lebensmittel spielen bei der Exposition gegenüber Benzol eine untergeordnete Rolle [D - 1334 / AIR / 2020].
In einer belgischen Untersuchung von 455 Lebensmittelproben konnte Benzol in 58 % der Proben, insbesondere in geräuchertem Fisch in Dosen, oberhalb der Bestimmungsgrenze quantifiziert werden [D - 1338 / Medeiros Vinci et al. / 2012].
Benzol ließ sich in 110 von 472 Olivenölproben (ca. 23 %) nachweisen. 103 Proben (ca. 22 %) enthielten Mengen von Spuren bis zu 0,05 mg/kg, wobei die meisten Werte nahe der Bestimmungsgrenze lagen. In nur 7 Proben (ca. 1,5 %) konnten mehr als 0,05 mg Benzol pro Kilogramm bestimmt werden. Der höchste Wert lag bei 0,133 mg/kg gefolgt von 0,123, 0,075, 0,072, 0,068, 0,06 und 0,058 mg/kg [E - 261 / BfR / 1995].
0,25 - 0,82 µg/kg (Getränke mit Kirschgeschmack, n = 68, n=5> BG, BG=<0,10/<0,20 µg/kg, Braunschweig/Hannover, Jahr 2020) [E - 259 / LAVES / 2024].
Vorkommen in Verbraucherprodukten
Siehe „Verwendung“ – „Gewerbliche Verwendung“ und „Verbraucherprodukte“
Weitere Angaben
Hausstaub
Zum Vorkommen in Hausstaub liegen in der verwendeten Literatur keine Angaben vor.
Tabakrauch
10-100 µg/Zigarette [C - 49 / Rippen / 2023]
410 µg/Zigarette (MW, n=6 Marken) [C - 49 / Rippen / 2023]
2,3 µg/m³ (Median, AM: 3,7 µg/m³, MIN-MAX: 0,4-11,9 µg/m³, n=41, Raucherräume in Cafés und Restaurants, Girona, ESP, Publikation 2009) [A - 1 / HSDB / 2014].
Zusammenfassung
In der Außenluft der BRD liegen Konzentrationen ländlicher Regionen nach wie vor unterhalb von 1 µg Benzol/m³, während städtische Konzentrationen insbesondere im Bereich der Emissionsquellen heute im Jahresmittel mit maximal <1,5 µg/m³ (verkehrsnah) bzw. maximal etwa 3 µg/m³ (industrienah) im Vergleich zu den letzten Jahrzehnten deutlich gesunken sind.
Die Durchschnittskonzentrationen in der Innenraumluft wurde Mitte der 80er Jahre mit 8 µg Benzol/m³ angegeben ohne Berücksichtigung von Außeneinflüssen z. B. durch den Kfz-Verkehr. Raucherhaushalte weisen im Vergleich zu Nichtraucherhaushalten im Mittel höhere Werte auf. In Haushalten ohne besondere Benzolquellen lag die Belastungen im Mittel unter 4 µg Benzol/m³. Aktuelle Daten ab dem Jahr 2000 deuten auf mittlere Innenraumluftkonzentrationen zwischen <1 und 1,8 µg/m³. Untersuchungen in 615 Wohnräumen im Rahmen des fünften deutschen Umweltsurveys ergaben einen Mittelwert von 1,5 µg/m³. Dabei weisen die Innenraumkonzentrationen durch den Einfluss der Immissionssituation einen saisonalen Verlauf mit höheren Benzolbelastungen im Winter und geringeren Belastungen im Sommer auf [C - 7 / Wichmann / 2023].
In KFZ-Innenräumen werden in der Regel deutlich höhere Konzentrationen im Vergleich zu Außen- und Innenraumluftkonzentrationen in Gebäuden nachgewiesen.
|

|
Aufnahmewege
|
|
|
Geschätzte Gesamtexposition
130-550 µg/d (Exposition/geschätzte Gesamtaufnahme, ohne Rauchen, DE; Jahr ca. 1990) [C - 49 / Rippen / 2023].
700-1.200 µg/d (Exposition/geschätzte Gesamtaufnahme, mit 20 Zigaretten, DE; Jahr ca. 1990) [C - 49 / Rippen / 2023].
Inhalative Aufnahme
Über die Außenluft
<2-60 µg/d (Gesamtzufuhr, DE; Jahr ca. 1990) [C - 49 / Rippen / 2023].
0,4 µg/d (2 % der Gesamtzufuhr, DE; Jahr ca. 1995, Annahmen: 0,5 µg/m³ Luftkonzentration, 1,7 m³ Atemvolumen bei 2 h/d Expositionsdauer und 50 % Resorption) [C - 7 / Wichmann / 2023].
Nach einer Studie aus dem Jahr 2001 beträgt die von Kleinkindern (im Alter von unter einem Jahr) pro Tag eingeatmete Benzolmenge in ländlichen Gebieten 15,3 µg, in urbanen Gebieten 19,7 µg und in urbanen Gebieten bei Passivrauch-Exposition 25,9 µg [E - 262 / BfR / 2013].
Über die Raumluft
150 µg/d (maximale Gesamtzufuhr, DE; Jahr ca. 1990) [C - 49 / Rippen / 2023].
13 µg/d (75 % der Gesamtzufuhr, DE; Jahr ca. 1995, Annahmen: 1,5 µg/m³ Luftkonzentration, 17,5 m³ Atemvolumen bei 21 h/d Expositionsdauer und 50 % Resorption) [C - 7 / Wichmann / 2023].
KFZ-Innenraum
4 µg/d (23 % der Gesamtzufuhr, DE; Jahr ca. 1995, Annahmen: 10 µg/m³ Luftkonzentration, 0,8 m³ Atemvolumen bei 1 h/d Expositionsdauer und 50 % Resorption) [C - 7 / Wichmann / 2023].
Weitere inhalative Aufnahmewege
Umgebungsluft/Atemluft
30-300 µg/d (Exposition/Aufnahme, DE; Jahr ca. 1990) [C - 49 / Rippen / 2023].
Die Benzolmenge, die über die Atemluft aufgenommen wird, kann variieren, liegt aber bei Nichtrauchern etwa in der Größenordnung von 50 bis 100 µg pro Tag, wobei die eingeatmete Benzolmenge in verkehrsreichen urbanen Gebieten höher ist als in verkehrsarmen ländlichen Gebieten. Raucher nehmen mehrere hundert µg Benzol pro Tag zusätzlich auf. Auch das Passivrauchen stellt eine relevante Aufnahmequelle dar [E - 262 / BfR / 2013].
Tabakrauch
400 µg/d (Gesamtzufuhr, DE; Jahr ca. 1990) [C - 49 / Rippen / 2023].
7 µg/d (Gesamtzufuhr, Passivrauchen, DE; Jahr ca. 1990) [C - 49 / Rippen / 2023].
Orale Aufnahme
Die WHO (World Health Organisation) schätzte die Zufuhr von Benzol über Nahrungsmittel (einschl. Trinkwasser) in den USA und Kanada mit höchstens 1,4 µg/Tag ab [C - 150 / EHC / 1993; D - 1334 / AIR / 2020].
Über das Trinkwasser
1-5 µg/d (Exposition/Aufnahme, Gesamtzufuhr: <1 µg/d, DE; Jahr ca. 1990) [C - 49 / Rippen / 2023].
Über Lebensmittel
Die mittlere tägliche Aufnahme über alle Nahrungsmittelgruppen errechnete sich unter Verwendung des „upper bound“ in der Studie von [D - 1338 / Medeiros Vinci et al. / 2012] zu 0,020 µg/kg Körpergewicht (97,5. Perzentil: 0,078 µg/kg KG).
100-250 µg/d (Exposition/Aufnahme Gesamtzufuhr: <1 µg/d, DE; Jahr ca. 1990) [C - 49 / Rippen / 2023].
Über Boden/Hausstaub
Zur Aufnahme über Boden oder Hausstaub liegen in der verwendeten Literatur keine Angaben vor.
Weitere orale Aufnahmewege
Zur Aufnahme über weitere orale Aufnahmewege liegen in der verwendeten Literatur keine Angaben vor.
Dermale Aufnahme
Über Verbraucherprodukte
Zur Aufnahme über Verbraucherprodukte liegen in der verwendeten Literatur keine Angaben vor.
Weitere dermale Aufnahmewege
Zur Aufnahme über weitere dermale Aufnahmewege liegen in der verwendeten Literatur keine Angaben vor.
Weitere Angaben
Keine Angaben
Zusammenfassung
Insgesamt werden die Aufnahme über die Atemluft in der Reihenfolge Innenräume, KFZ- Innenräume, Außenluft (unter Berücksichtigung der anzunehmenden täglichen Expositionsdauer) mit insgesamt zwischen 50 und 100 µg/d (je nach Konzentration in der Atemluft) als entscheidende Aufnahmepfade für die Gesamtexposition der Allgemeinbevölkerung (Nichtraucher) angesehen, während die Aufnahme über Lebensmittel und Trinkwasser insgesamt im Vergleich dazu unbedeutend angesehen wird. Das Rauchverhalten stellt einen entscheidenden Faktor für die Aufnahme sowohl über die Erhöhung der Innenraumbelastung und das Passivrauchen als auch für die direkte inhalative Zufuhr dar. Während Umweltbelastungen und damit die Aufnahme aus der Umgebungsluft in den letzten Jahrzehnten in Deutschland deutlich zurückgegangen sind, ist durch das Rauchen nach wie vor mit 10-410 µg/Zigarette auszugehen.
|

|
Human-Biomonitoring
|
|
|
Die am besten geeigneten Biomarker einer nicht-gewerblichen internen Exposition der Bevölkerung stellen Benzol, S-Phenylmercaptursäure (SPMA) und t,t-Muconsäure im Harn dar [D - 1334 / AIR / 2020].
Eine umfangreiche Aufstellung verfügbarer Untersuchungen zu den Gehalten von Benzol, SPMA und t,t-Muconsäure in Blut und Urin finden sich in [C - 7 / Wichmann / 2023, S. 10ff].
Die Ständige Senatskommission der Deutschen Forschungsgemeinschaft zur Prüfung gesundheitsschädlicher Arbeitsstoffe hat 2016 bzw. 2018 für drei Parameter u.a. auf Basis einer italienischen Studie von [D - 1341 / Campagna et al. / 2014] an 86 Nichtrauchern Referenzwerte auf Basis des 95.Perzentils der beruflich nicht gegenüber Benzol exponierten Personen der Allgemeinbevölkerung im erwerbstätigen Alter abgeleitet. Diese sogenannten Biologischen Arbeitsstoff-Referenzwerte betragen für Benzol im Harn
0,3 µg Benzol/L Harn,
0,3 µg SPMA/g Kreatinin,
150 µg t,t-Muconsäure/g Kreatinin
als Biologischen Arbeitsplatzreferenzwert (BAR) fest.
[C - 76 / DFG / 2015, 2018; C - 7 / Wichmann / 2023]
Aktuell wurden in der Deutschen Umweltstudie zur Gesundheit von Kindern und Jugendlichen (GerES V) repräsentative Daten für die in Deutschland lebenden Kinder und Jugendliche im Alter von 3-17 Jahren erhoben.
Das 95. Perzentil für SPMA beträgt 0,33 µg SPMA/g Kreatinin und der Median 0,08 µg SPMA/g Kreatinin für nichtrauchende Kinder und Jugendliche. Nur bei 2 % der Teilnehmenden lagen die Werte unterhalb der Bestimmungsgrenze von 0,02 µg/L [D - 1342 / Schwedler et al / 2021; D - 1334 / AIR / 2020].
Auf Grundlage der Ergebnisse dieser Studie wurden von der Kommission Human-Biominitoring des Umweltbundesamtes (UBA-HBM) folgende aktualisierte Referenzwerte (RV95) GerES V (2014-2017) für den Benzol-Metaboliten SPMA in Urin veröffentlicht [D - 1343 / Hoopmann et al. / 2023]:
weiblich, 3-11 Jahre, Nichtraucher
0,35 µg SPMA/L Urin (RV95=P95, n=655, 97,6 %<BG: 0,02 µg/L, MIN-MAX: <BG-0,96 µg/L, 95 % KI: 0,3-0,36 µg/L)
weiblich, 12-17 Jahre, Nichtraucher
0,38 µg SPMA/L Urin (RV95=P95, n=454, 96,3 %<BG: 0,02 µg/L, MIN-MAX: <BG-5,4 µg/L, 95 %KI: 0,32-0,41 µg/L)
männlich, 3-11 Jahre, Nichtraucher
0,32 µg SPMA/L Urin (RV95=P95, n=669, 98,5 %<BG: 0,02 µg/L, MIN-MAX: <BG-1,4 µg/L, 95 % KI: 0,29-0,38 µg/L)
männlich, 3-11 Jahre, Nichtraucher
0,29 µg SPMA/L Urin (RV95=P95, n=409, 96,3 %<BG: 0,02 µg/L, MIN-MAX: <BG-0,75 µg/L, 95 % KI: 0,24-0,29 µg/L)
In einer Vergleichsstudie zum Einfluss des Rauchverhaltens in Aachen (vor 2009) wurden folgende Konzentrationen an SPMA im Urin (in µg/g Kreatinin) ermittelt:
0,12 µg SPMA/g Kreatinin (Median, MIN-MAX:< 0,05-0,43 µg/g, n=43, Nichtraucher)
0,14 µg SPMA/g Kreatinin (Median, MIN-MAX:0,04-0,42 µg/g, n=13, Passivraucher)
1,30 µg SPMA/g Kreatinin (Median, MIN-MAX: 0,22-5,25 µg/g, n=73, Raucher)
[D - 1344 / Schettgen et al. / 2010]
<1-1,3 µg Benzol/L Humanblut (Median: < 1 µg/L, Erwachsene; n=85, DE, 1999-2003) [C - 49 / Rippen / 2023].
Human-Vollblut (DE, 1997):
Halle: 18-36 ng/L, geometrischer Mittelwert 26 ng/L (n=38)
Osterburg: 19-32 ng/L, geometrischer Mittelwert 25 ng/L (n=3165)
Essen: 21-41 ng/L, geometrischer Mittelwert 27 ng/L (n=26)
Borken: 16-71 ng/L, geometrischer Mittelwert 20 ng/L (n=51)
gesamt: 16-71 ng/L, geometrischer Mittelwert 24 ng/L (n=146)
[C - 49 / Rippen / 2023]
|

|
Quellen für Expositionsmöglichkeiten
|
|
|
A - 1
HSDB (Hazardous Substances Data Bank)
Datenbank-Hersteller: National Library of Medicine (NLM), Bethesda, USA
zur Online-Recherche in HSDB (ab 12/2019 in PubChem)
|
|
A - 10
Gestis (Gefahrstoffinformationssystem der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung)
Datenbankhersteller: Institut für Arbeitsschutz der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung - IFA
(ehemals Berufsgenossenschaftliches Institut für Arbeitsschutz - BGIA)
zur Online Recherche in Gestis
|
|
A - 45
PubChem
Datenbank-Hersteller: National Library of Medicine (NLM), Bethesda, USA
zur Online-Recherche in Pubchem
|
|
C - 7
Wichmann HE, Schlipköter HW, Fülgraff G (Hrsg.)
Handbuch der Umweltmedizin: Toxikologie, Epidemiologie,
Hygiene, Belastungen, Wirkungen, Diagnostik, Prophylaxe
Landsberg: Ecomed Verlagsgesellschaft 1992 ff.
Loseblattsammlung
(2023, Organische Verbindungen, Benzol)
|
|
C - 49
Rippen G (Bearb.)
Handbuch Umweltchemikalien: Stoffdaten, Prüfverfahren, Vorschriften
Landsberg: Ecomed Verlagsgesellschaft
Loseblattsammlung
|
|
C - 76
Deutsche Forschungsgemeinschaft, DFG
Greim H, Drexler H, Hartwig A (Hrsg.)
Biologische Arbeitsstoff-Toleranz-Werte (BAT-Werte), Expositionsäquivalente für krebserzeugende Arbeitsstoffe (EKA),
Biologische Leitwerke (BLW) und Biologische Arbeitsstoff-Referenzwerte (BAR): Arbeitsmedizinisch-toxikologische Begründungen
PUBLISSO ZB Med-Pubilikationsportal Lebenswissenschaften, Loseblattsammlung
Online (1972-2018): https://repository.publisso.de/resource?query%5B0%5D%5Bfacets%5D%5BcreatedBy%5D%5B0%5D=335
Online (ab 2019): https://series.publisso.de/de/pgseries/overview/mak/dam/allContents
(2015, 22. Lfg.; 2018 Vol. 3 Nr. 1 Addendum zu Benzol)
|
|
C - 150
International Programme on Chemical Safety (IPCS) (Hrsg.)
Environmental Health Criteria
Geneva: WHO
Serie https://inchem.org/pages/ehc.html
|
|
C - 248
Landesamt für Natur, Umwelt und Klima Nordrhein-Westfalen (LANUK, NRW)
(ehemals Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz Nordrhein-Westfalen (LANUV, NRW))
Immissionen, Jahreskenngrößen, 1999 -
Online: https://luftqualitaet.nrw.de
|
|
C - 458
Hofmann H, Erdmann G, Müller A
Zielkonflikt energieeffiziente Bauweise und gute Raumluftqualität - Datenerhebung für flüchtige organische Verbindungen in der Innenraumluft von Wohn- und Bürogebäuden (Lösungswege)
Arbeitsgemeinschaft ökologischer Forschungsinstitute (AGÖF) e.V., im Auftrag des Umweltbundesamtes,
Förderkennzeichen (UFOPLAN) 3709 62 211
Online: https://www.agoef.de/fileadmin/user_upload/dokumente/forschung/AGOEF-Abschlussbericht_VOC_DB_II-barrierefrei.pdf
|
|
C - 527
European Chemicals Agency, ECHA
Committee for Risk Assessment (RAC)
Opinions on scientific evaluation of occupational exposure limits
Online: https://echa.europa.eu/de/oels-activity-list
|
|
C - 528
Umweltbundesamt, UBA
Bericht des Bundesministeriums für Gesundheit und des Umweltbundesamtes an die Verbraucherinnen und Verbraucher über die Qualität von Wasser für den menschlichen Gebrauch (Trinkwasser) in Deutschland (2017-2019)
Umwelt und Gesundheit, 01/2021
Online: https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/5750
|
|
C - 530
Richtlinie 98/70/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 13. Oktober 1998 über die Qualität von Otto- und Dieselkraftstoffen und zur Änderung der Richtlinie 93/12/EWG des Rates
ABl. L350 28.12.1998, S.58-68
Online: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/ALL/?uri=CELEX:31998L0070
(aktuelle konsolidierte Fassung 20.11.2023)
|
|
D - 683
Umweltbundesamt, UBA
Vergleichswerte für flüchtige organische Verbindungen (VOC und Aldehyde) in der Innenraumluft von Haushalten in Deutschland
Ergebnisse des repräsentativen Kinder-Umwelt-Surveys (KUS) 2003/06
Bundesgesundheitsblatt-Gesundheitsforschung-Gesundheitsschutz, 2008 51 S.109-112
|
|
D - 776
Krause C, Chutsch M, Henke M et al
Umwelt-Survey, Band IIIc: Wohn-Innenraum. Raumluft
Umweltbundesamt WaBoLu-Heft 04/1991
Online: https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/377/publikationen/wabolu_hefte_4-1991
|
|
D - 1042
Fromme H, Heitmann D, Dietrich S et al.
Raumluftqualität in Schulen - Belastung von Klassenräumen mit Kohlendioxid (CO2), flüchtigen organischen Verbindungen (VOC), Aldehyden, Endotoxinen und Katzenallergenen
Gesundheitswesen, 2008 70 S.88-97
|
|
D - 1334
Ausschuss für Innenraumrichtwerte, AIR
Vorläufiger Leitwert für Benzol in der Innenraumluft
Bundesgesundheitsblatt-Gesundheitsforschung-Gesundheitsschutz, 2020 63 S.361-367
Online: https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/4031/dokumente/benzol_2020.pdf
|
|
D - 1338
Medeiros Vinci R, Jacxsens L, Van Loco J et al.
Assessment of human exposure to benzene through foods from the Belgian market
Chemosphere, 2012 88 S.1001-1007
Online: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/22483726/
|
|
D - 1339
Untersuchungsstelle für Umwelttoxikologie des Landes Schleswig-Holstein, UfU
Vorkommen von flüchtigen Luftverunreinigungen in Schulen und Kindergärten
Jahresbericht der Untersuchungsstelle für Umwelttoxikologie des Landes Schleswig-Holstein 1992/93, 1994
|
|
D - 1340
Landesamt für soziale Dienste Schleswig-Holstein, LAsD
Raumluftuntersuchungen in öffentlichen Gebäuden in Schleswig-Holstein.
Teil 1: Hintergrundwerte für Schulen und Kindergärten (Schul- und Kindergartenstudie 2005 / 2007)
Ministerium für Soziales, Jugend, Familie, Senioren, Integration und Gleichstellung (Hrsg.), 2009
Online: https://www.schleswig-holstein.de
|
|
D - 1341
Campagna M, Satta G, Campo L et al.
Analysis of potential influence factors on background urinary benzene concentration among a non-smoking, non-occupationally exposed general population sample
International Archive of Occupational and Environmental Health, 2014 87(7) S.793-799
Online: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/24370553
|
|
D - 1342
Schwedler G, Murawski A, Schmied-Tobies MIH et al.
Benzene metabolite SPMA and acrylamide metabolites AAMA and GAMA in urine of children and adolescents in Germany - human biomonitoring results of the German Environmental Survey 2014-2017 (GerES V)
Environmental Research, 2021 192 110295
Online: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33065072
|
|
D - 1343
Hoopmann M, Murawski A, Schümann M et al.
Human Biomonitoring Commission of the German Environment Agency
A revised concept for deriving reference values for internal exposures to chemical substances and its application to population-representative biomonitoring data in German children and adolescents 2014-2017 (GerES V)
International Journal of Hygiene and Environmental Health, 2023 253 114236
Online: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/37579634
|
|
D - 1344
Schettgen T, Ochsmann E, Alt A et al.
A biomarker approach to estimate the daily intake of benzene in non-smoking and smoking individuals in Germany
Journal of Exposure Science & Environmental Epidemiology, 2010 20(5) S.427-433
Online: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/19491941
|
|
E - 259
Niedersächsisches Landesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit, LAVES
Benzol in Getränken mit Kirschgeschmack: Ein Problem? Stand 2024
Online: https://www.laves.niedersachsen.de/startseite/lebensmittel/lebensmittelgruppen/getranke/benzol-in-getranken-mit-kirschgeschmack-ein-problem-203643.html
|
|
E - 260
Bundesinstitut für Risikobewertung, BfR
A-Z Index, Eintrag Benzol, Recherche 09/2024
|
|
E - 261
Bundesinstitut für Risikobewertung, BfR
Chronologie der Ereignisse im Zusammenhang mit dem Nachweis von aromatischen Kohlenwasserstoffen (AKW) in Olivenöl
Stellungnahme des BgVV, 01/1995
Online: https://www.bfr.bund.de/cm/343/nachweis_von_aromatischen_kohlenwasserstoffen_akw_in_olivenoel.pdf
|
|
E - 262
Bundesinstitut für Risikobewertung, BfR
Fragen und Antworten zu Benzol in Erfrischungsgetränken und Karottensäften
Aktualisierte FAQ des BfR, 16. Dezember2013
Online: https://www.bfr.bund.de/cm/343/fragen-und-antworten-zu-benzol-in-erfrischungsgetraenken-und-karottensaeften.pdf
|
|
E - 263
Landesamt für Natur Umwelt und Verbraucherschutz Nordrhein-Westfalen, LANUV
Trinkwasserqualität in NRW, 2020
Online: https://www.lanuk.nrw.de/fileadmin/lanuv/wasser/pdf/TW-Qualität_2020_final.pdf
|
|
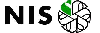
 Stoffsuche
Stoffsuche
 Benzol NIS-Nr.: 1
Benzol NIS-Nr.: 1
